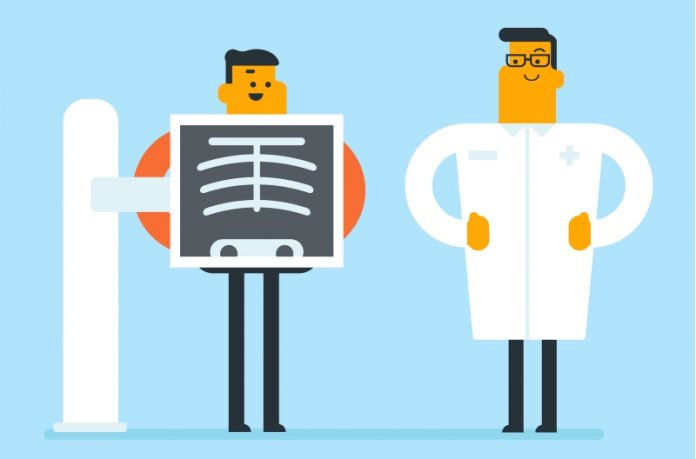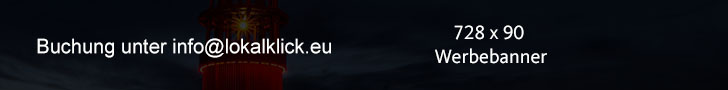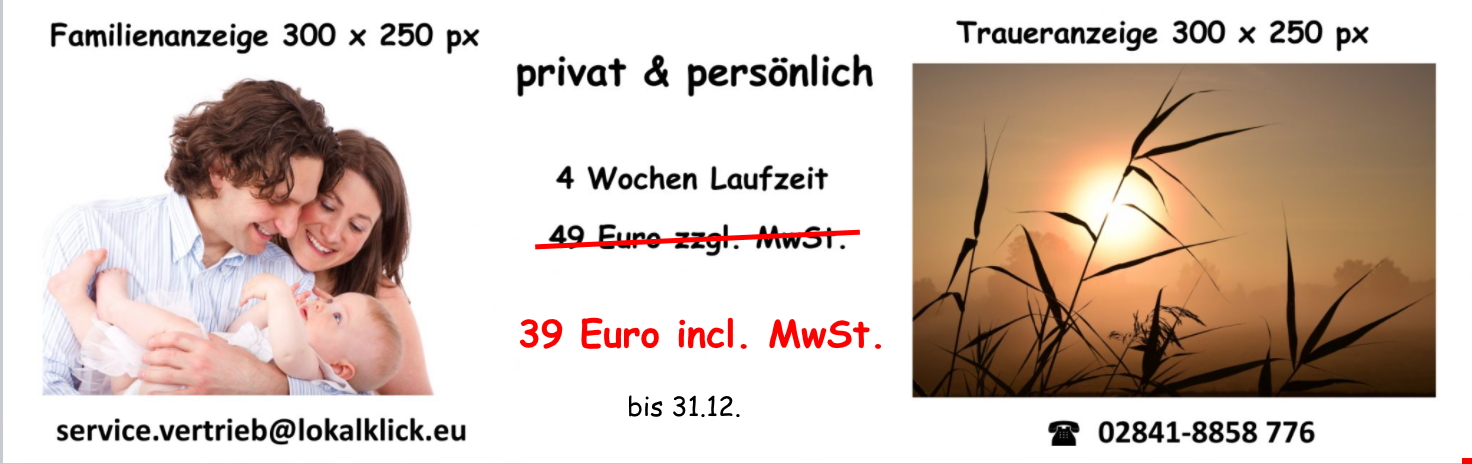Duisburg. Rund um Radiologen, Röntgen und Co. herrschen zahlreiche Vorurteile. Dabei ist der Radiologie durchaus Patientenfreund und die Strahlenbelastung pro Aufnahme mittlerweile stark gesunken.
Der Radiologe mag keine Patienten, von Röntgenstrahlen bekommt man Krebs und im MRT Platzangst – rund um das Fachgebiet der Radiologie sind viele Irrtümer noch immer weit verbreitet. Fakt ist aber: Kaum ein anderer Bereich der Medizin entwickelt sich so schnell und wird dabei so unterschätzt wie die „Wissenschaft der Strahlen“. Immerhin hat sich etwa die Röntgendosis in den letzten Jahren um teils bis zu 90 Prozent pro Aufnahme reduziert und viele Diagnosen wäre ohne Bilder nicht möglich. Priv.-Doz. Dr. Marco Das, Chefarzt der diagnostischen und interventionellen Radiologie am Helios Klinikum Duisburg, klärt über die wichtigsten Irrtümer auf.
Von Röntgenuntersuchungen bekommt man Krebs
Diese Annahme ist immer noch weit verbreitet, aber eine eigentlich unbegründete Sorge, denn wie immer macht auch hier die Dosis das Gift. Und die ist bei einer klassischen Röntgenuntersuchung extrem gering. Ein Beispiel: Bei einer Aufnahme der Lunge entsteht heutzutage nur noch eine effektive Strahlendosis von rund 0,01-0,03 Millisievert (mSv). Zum Vergleich: Ein Flug von Deutschland nach Japan weist eine ähnliche Dosis auf und die jährliche natürliche Strahlenbelastung in Deutschland, der jeder ausgesetzt ist, beträgt etwa 2 mSv. Experten gehen davon aus, dass ein Effekt auf Zellen und Erbgut unseres Körpers bei diesen Größenordnungen nahezu nicht nachweisbar ist. Anders sieht es erst bei höheren Dosen aus: Ab etwa 500mSv treten Hautrötungen, ab 1000 mSv Übelkeit und Erbrechen auf. Dabei kann es auch zu zufälligen Erbgutschädigungen kommen, die der Körper entweder selbst repariert oder aus denen später Krebszellen entstehen können. Trotzdem gilt für den Radiologen auch bei den viel geringeren Dosen der Bildgebung immer: Der potentielle Nutzen muss das mögliche Risiko überwiegen.
Eine Röntgenaufnahme ist harmloser als eine Computertomografie (CT)
Auch wenn beide Untersuchungsmethoden auf dem Prinzip der Röntgenstrahlung beruhen, handelt es sich doch um zwei völlig verschiedene Verfahren, die sich kaum vergleichen lassen. Etwa wird bei einfachen Knochenbrüchen zunächst ein Röntgenbild angefertigt. Ist die Fraktur aber besonders komplex, braucht es eine CT zur genaueren Darstellung, beispielsweise um eine notwendige Operation besser vorzubereiten. Auch wenn die Dosis bei letzterem höher liegt – eine Aufnahme vom Hirnareal liegt etwa zwischen 1 bis 3 mSv – überwiegt hier der Nutzen. Das gilt auch für die Tumordiagnostik: Denn auf einem einfachen Röntgenbild lassen sich bestimmte Gewebearten gar nicht erst darstellen. So könnten etwa sehr kleine, verstreute Metastasen unentdeckt bleiben. Kurz gesagt: Das Krankheitsbild entscheidet darüber, welches bildgebende Verfahren geeignet und notwendig ist.
Kontrastmittel sind gesundheitsschädlich und verbleiben zum Teil im Körper
Hier muss man zwischen den verschiedenen Kontrastmitteln unterscheiden: Zum einen gibt es jodhaltige für die Röntgen- und CT-Diagnostik. Zum anderen kommt bei MRT-Untersuchungen ein gadolineumhaltiges Kontrastmittel zum Einsatz. Bei gesunden Menschen verursachen beide Varianten normalerweise keine Schädigungen – abgesehen von sehr seltenen allergischen Reaktionen – und werden über die Niere wieder ausgeschieden. Bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion wiederum kann ein jodhaltiges Kontrastmittel Probleme bereiten. Auch bei einer Schilddrüsenüberfunktion kann es durch die plötzliche Jodzufuhr zu einer sogenannten thyreotoxischen Krise, einer Entgleisung der Schilddrüsenwerte, kommen. Diese beiden Krankheitsbilder sollten daher vorher immer abgeklärt werden. Kürzlich wurde immer wieder über Gadolineumablagerungen im Gehirn berichtet, allerdings konnte bislang kein Zusammenhang mit einer Erkrankung oder der Bildgebung nachgewiesen werden.
Make-Up oder Tattoos beeinflussen die Bildgebung
Viele Patienten haben heutzutage Tattoos oder permanentes Make-up. Das ist kein Ausschlusskriterium für die Bildgebung, es kann jedoch in seltenen Fällen zu Störungen auf den Aufnahmen oder zu ungewohnten Wärme- oder auch Schmerzempfindungen kommen. Deshalb werden Patienten im Vorfeld, etwa zu MRT-Untersuchungen, danach befragt und sollten alle Körperstellen benennen. Treten die Symptome auf, kann die Untersuchung jederzeit abgebrochen werden. Aber das ist, wie gesagt, extrem selten. Wichtig übrigens auch: Piercings und anderes Metall im Körper müssen unbedingt angegeben werden.
Im MRT-Gerät bekommt man Platzangst
Dass es schönere Orte als die sogenannte „Röhre“ gibt, ist unbestritten. Doch es gibt gute Nachrichten für die rund 15 Prozent der Patienten mit potentieller Platzangst: Die neuen Geräte werden immer luftiger gebaut. Allerdings müssen manche Menschen, je nachdem welche Körperregion untersucht wird, noch mit zusätzlichen „Spulen“ eingepackt werden. Das kann das Engegefühl verstärken. Um einer möglichen Panik vorzubeugen, ist der Betroffene deshalb ständig mit der durchführenden MTRA (Medizinisch-technisch-radiologische Assistentin) in Kontakt. Sie kann notfalls sofort eingreifen. Dieses Wissen beruhigt die meisten Patienten sehr. Aber auch die Gabe von Beruhigungsmitteln oder das Mitbringen einer Begleitperson ist möglich.
Ein Radiologe sitzt nur am Bildschirm
Die Hauptaufgabe des Radiologen besteht tatsächlich in der Auswertung der gemachten Bilder. Trotzdem wäre das ein zu einseitiges Bild, vor allem im Klinikalltag gibt es neben den Gesprächen mit Patienten und der Anwesenheit in zahlreichen Fallkonferenzen mit Kollegen noch eine Vielzahl weiterer Aufgaben. Dazu gehört etwa die sogenannte interventionelle Radiologie, bei der der Radiologe am Patienten mit Hilfe von Kathetern unter anderem Tumoren in der Leber behandelt. Auch Durchleuchtungsuntersuchungen, Mammografien und Ultraschall sind Teil seines Fachgebietes. Der direkte Kontakt ist Teil davon, etwa bei der Aufklärung, dem Legen eines Zugangs oder der Betreuung von Intensivpatienten oder Schwerverletzten.
Welche Körperteile sind besonders strahlungsanfällig?
Grundsätzlich ist Gewebe mit einer höheren Zellteilung strahlensensibler. Das betrifft die Reproduktionsorgane, die Schilddrüse, das blutbildende Knochenmark und die weibliche Brustdrüse.
Wie viel Einfluss hat der Stand des Gerätes auf die Untersuchungsergebnisse?
Es hat momentan noch weniger Einfluss auf das Ergebnis als auf die Belastung für den Patienten. Denn die Geräte der neuesten Generationen können mit deutlich weniger Röntgenstrahlung ebenso qualitativ hochwertige Bilder erzeugen wie ihre Vorgänger. Das hat vor allem mit verbesserter Detektortechnik, aber auch mit veränderter Technik der Röntgenröhren zu tun. Kurz: Je neuer das Gerät, desto schonender die Aufnahme.